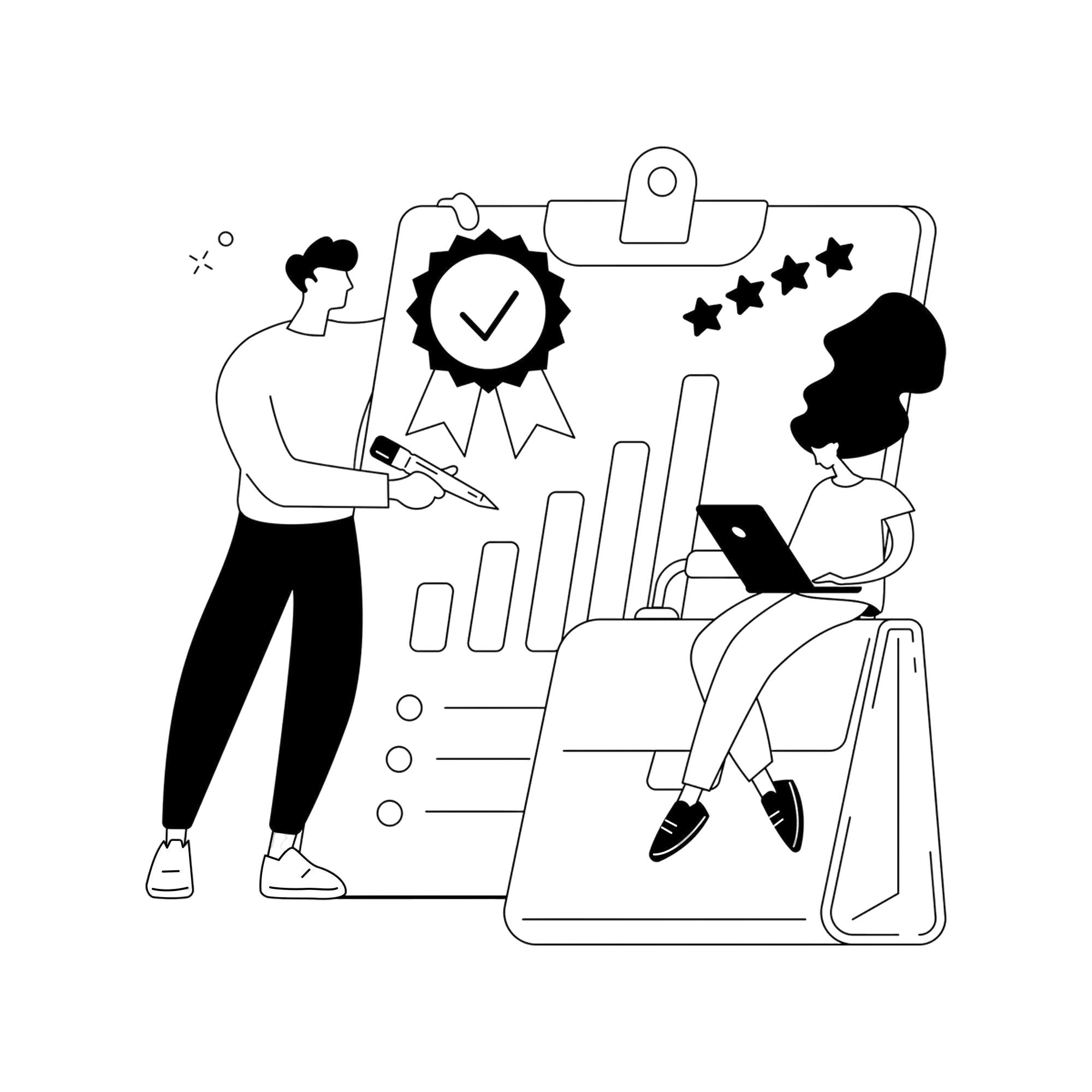Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie eine Gefährdungsbeurteilung (kurz GBU) nicht nur gesetzeskonform, sondern auch effizient und praxisnah erstellen können? In unserem Beitrag „Was ist eine Gefährdungsbeurteilung“ erfahren Sie alles über die gesetzlichen Grundlagen, die Bedeutung der GBU und warum sie ein zentraler Bestandteil des Arbeitsschutzes ist und zu Ihren Pflichten als Arbeitgeber gehört.
Dieser Beitrag von Arbeitssicherheit.GmbH widmet sich der praktischen Umsetzung, wenn Sie eine Gefährdungsbeurteilung erstellen möchten: Wie erfassen Sie alle relevanten Gefährdungen und potenziellen Risiken? Wie bewerten Sie diese systematisch und leiten daraus wirksame Arbeitsschutzmaßnahmen ab?
In der Praxis haben sich dabei sieben Schritte als besonders hilfreich erwiesen, um eine Gefährdungsbeurteilung strukturiert und umfassend zu erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dabei vorgehen und worauf es in jeder Phase ankommt – von der Erfassung der Arbeitsbereiche bis hin zur Dokumentation der Ergebnisse.
| 💡 Bevor Sie mit der eigentlichen Gefährdungsbeurteilung beginnen, ist eine sorgfältige Vorbereitung vorteilhaft. Schaffen Sie eine klare Struktur für den gesamten Prozess und legen Sie Verantwortlichkeiten fest. Eine gut organisierte Vorbereitung spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Unternehmen die Gefährdungen systematisch und lückenlos beurteilt. |
Schritt 1: Legen Sie Arbeitsbereiche und Tätigkeiten fest
Der erste Schritt der Gefährdungsbeurteilung besteht darin, die Arbeitsbereiche und Tätigkeiten im Unternehmen zu analysieren. Dabei sollten Sie die gesamte Betriebsorganisation betrachten, um sicherzustellen, dass keine relevanten Bereiche oder Tätigkeiten übersehen werden.
Die drei Arten der Gefährdungsbeurteilung:
- Arbeitsbereichsbezogene Gefährdungsbeurteilung:
Hier werden räumliche Bereiche oder Arbeitsplätze definiert, die denselben Gefährdungen ausgesetzt sind, z. B. Produktionshallen, Büroarbeitsplätze oder Lagerbereiche. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen können Arbeitsplätze oder Tätigkeiten zusammengefasst werden. - Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung:
Diese Form konzentriert sich auf spezifische Tätigkeiten, wie das Bedienen von Maschinen, Außendiensttätigkeiten oder Homeoffice-Arbeiten. Tätigkeiten, die arbeitsbereichsübergreifend ausgeführt werden, wie Reparatur, Wartung oder Instandhaltung, sollten beim Erstellen der Gefährdungsbeurteilung gesondert betrachtet werden. - Personenbezogene Gefährdungsbeurteilung:
Die Beurteilung ist besonders für schutzbedürftige Gruppen wie werdende oder stillende Mütter, Jugendliche, Praktikanten, Leiharbeitnehmer oder Menschen mit Behinderungen relevant. Auch Beschäftigte ohne ausreichende Deutschkenntnisse oder mit besonderen gesundheitlichen Anforderungen sollten dabei berücksichtigt werden.
Was Sie noch beachten sollten, wenn Sie eine Gefährdungsbeurteilung erstellen:
- Dauer und Häufigkeit der Tätigkeiten:
Für bestimmte Tätigkeiten, wie beim Umgang mit Gefahrstoffen oder bei Feuchtarbeit, ist es wichtig, die Dauer und Häufigkeit (z. B. täglich, quartalsweise, jährlich) zu erfassen. - Abstimmung bei mehreren Arbeitgebern:
Werden in einem Arbeitsbereich Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig, wie beispielsweise auf Baustellen oder in Arzt- und Bürogemeinschaften, müssen die Arbeitgeber Maßnahmen zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen abstimmen.
Schritt 2: Ermitteln Sie Gefährdungen und Belastungen
Der zweite Schritt der Gefährdungsbeurteilung besteht darin, Gefährdungen und Belastungen systematisch zu identifizieren. Ziel ist es, potenzielle Gefahrenquellen sowie die Bedingungen, unter denen diese Gefährdungen auftreten, zu erkennen und zu beschreiben.
Was wird ermittelt?
Gefährdungen können von Gefahrstoffen, Infektionserregern, Maschinen oder Geräten am Arbeitsplatz ausgehen. Belastungen hingegen entstehen durch äußere Bedingungen und Anforderungen, die Beschäftigte physisch oder psychisch beeinträchtigen können, wie etwa einseitige körperliche Belastungen, Termindruck oder psychische Beanspruchungen.
Wie gehen Sie vor?
Eine vorausschauende Gefährdungsbeurteilung ist entscheidend für die Prävention. Dabei sollten Sie folgende Methoden nutzen:
- Betriebsbegehungen: Beobachten Sie Arbeitsbereiche und Tätigkeiten vor Ort.
- Personalbefragungen: Holen Sie Feedback von Mitarbeitenden ein, um Belastungen und Gefährdungen aus ihrer Perspektive zu erfassen.
- Interviews oder Workshops: Diskutieren Sie mögliche Gefährdungen und Lösungen im Team.
- Prozessanalysen: Analysieren Sie Arbeitsabläufe, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
- Sicherheitstechnische Überprüfungen: Kontrollieren Sie Arbeitsmittel und Maschinen auf mögliche Gefahren.
Zusätzlich sollten Sie vorhandene Daten und Dokumente auswerten, wie Unfallberichte und Beinahe-Unfälle, Protokolle von Betriebsbegehungen, Sicherheitsdatenblätter und Herstellerinformationen sowie Ergebnisse von Messungen, wie beispielsweise zu Lärm oder Gefahrstoffen
Durch diese systematische Vorgehensweise schaffen Sie eine fundierte Grundlage, um Gefährdungen und Belastungen umfassend zu beurteilen und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten.
Jetzt Gefährdungsbeurteilung anfragen!
Unsere Fachkräfte beraten und unterstützen Sie in Ihrem Unternehmen und erstellen Ihre Gefährdungsbeurteilung für Sie!
Schritt 3: Bewerten Sie Gefährdungen in Ihrem Unternehmen
Ziel der Bewertung ist es, festzustellen, ob Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit gewährleistet sind oder ob Handlungsbedarf besteht.
Wie bewerten Sie Gefährdungen?
Die Bewertung erfolgt anhand von Vorschriften, rechtlichen Vorgaben und anerkannten Bewertungsmaßstäben, wie Grenzwerten und Schutzzielen. Zusätzlich können der Stand der Technik, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische Erkenntnisse sowie branchenspezifische Informationen herangezogen werden. Fehlen solche Maßstäbe, müssen betriebliche Kriterien entwickelt werden, die Aspekte wie Art, Ausmaß, Dauer und Häufigkeit der Gefährdung berücksichtigen.
Risikokategorien zur Bewertung:
- Grün – Geringes Risiko:
Gefährdungen, die selten auftreten und nur leichte Gesundheitsschäden verursachen könnten, gelten als tolerierbar. Hier besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf. - Gelb – Mittleres Risiko:
Gefährdungen, die möglicherweise auftreten und gesundheitliche Schäden hervorrufen könnten, erfordern mittel- bis langfristige Maßnahmen zur Risikoreduzierung. Kurzfristig können diese Risiken mit Vorsicht toleriert werden. - Rot – Hohes Risiko:
Gefährdungen, die sehr wahrscheinlich eintreten oder schwere gesundheitliche Folgen haben könnten, erfordern sofortige Maßnahmen. In einigen Fällen ist eine sofortige Einstellung der Arbeit notwendig.
Die Ergebnisse der Bewertung können in zwei Kategorien unterteilt werden:
- Wenn die Bewertung zeigt, dass die festgelegten Sicherheitsstandards oder Grenzwerte nicht erfüllt sind, müssen sofort Maßnahmen ergriffen werden, um die Gefährdung zu beseitigen oder zumindest zu verringern. Das bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen aktuell nicht sicher genug sind und eine direkte Verbesserung notwendig ist.
- Wenn die Sicherheitsstandards hingegen erfüllt sind, besteht kein akuter Handlungsbedarf. Die Arbeitsbedingungen sind in diesem Fall ausreichend sicher. Trotzdem sollte immer daran gearbeitet werden, die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz weiter zu verbessern, um mögliche Risiken langfristig zu minimieren.
Schritt 4: Legen Sie Schutzmaßnahmen fest und priorisieren Sie diese
Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung dienen als Grundlage für das Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen. Dabei ist es wichtig, die Maßnahmen nach den gesetzlichen Vorgaben und der Rangfolge der Schutzmaßnahmen, dem sogenannten STOP-Prinzip, zu priorisieren. Diese Reihenfolge sollte immer eingehalten werden, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu gewährleisten.
Das STOP-Prinzip beim Festlegen der Schutzmaßnahmen
Substitution: Die effektivste Maßnahme ist, die Gefahrenquelle direkt zu beseitigen. Dies kann durch den Austausch gefährlicher Stoffe gegen ungefährliche Alternativen oder durch die Umstellung auf sichere Arbeitsverfahren erreicht werden.
Technische Maßnahmen: Wenn die Gefahrenquelle nicht beseitigt werden kann, sollten technische Lösungen wie Absperrungen, Verkleidungen oder räumliche Trennungen eingesetzt werden, um die Gefährdung zu minimieren.
Organisatorische Maßnahmen: Sind technische Maßnahmen nicht ausreichend, können organisatorische Regelungen helfen, wie zum Beispiel das Beschränken des Aufenthalts im Gefahrenbereich, die Einführung von Schichtplänen oder die Anpassung von Arbeitsabläufen.
Persönliche Schutzmaßnahmen: Wenn alle anderen Maßnahmen nicht ausreichen, ist der Einsatz persönlicher Schutzausrüstung wie Gehörschutz, Schutzbrillen oder Sicherheitsschuhe notwendig.
Die Einhaltung dieser Rangfolge stellt sicher, dass Gefährdungen möglichst an der Quelle beseitigt werden, bevor auf weniger wirksame Maßnahmen zurückgegriffen wird. Persönliche Schutzmaßnahmen sollten immer die letzte Option sein, da sie stark von der korrekten Anwendung durch die Beschäftigten abhängen.
Auch wirtschaftliche Überlegungen spielen eine Rolle beim Festlegen von Arbeitsschutzmaßnahmen. Investitionen in Schutzmaßnahmen können sich jedoch langfristig lohnen, da sie Unfälle, Berufskrankheiten und Fehlzeiten reduzieren.
Schritt 5: Setzen Sie die Schutzmaßnahmen um
Um die Schutzmaßnahmen erfolgreich umzusetzen, sollten Beschäftigte und Führungskräfte frühzeitig einbezogen werden. Dies fördert sowohl das Verständnis als auch die Akzeptanz der Maßnahmen. Es ist wichtig, klare Verantwortlichkeiten für die Durchführung festzulegen, Termine zu vereinbaren und die Umsetzung zu dokumentieren.
Die Maßnahmen sollten nach Priorität umgesetzt werden. Zuerst müssen Gefährdungen mit dem höchsten Risiko beseitigt werden, also jene mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und den schwerwiegendsten Folgen.
Für eine effektive Durchführung ist es sinnvoll, eine Ablaufplanung zu erstellen, insbesondere bei umfangreichen Maßnahmen. Diese sollte Übergangsmaßnahmen, Meilensteine und beteiligte Personen berücksichtigen.
Schritt 6: Überprüfen Sie die Wirksamkeit Ihrer Schutzmaßnahmen
Nach der Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist es wichtig, deren Wirksamkeit zu überprüfen und die Ergebnisse dieser Überprüfung zu dokumentieren. Ziel ist es festzustellen, ob die Maßnahmen wie geplant umgesetzt wurden und ob sie dazu beigetragen haben, die Gefährdungen zu beseitigen oder ausreichend zu reduzieren.
Die Überprüfung kann durch verschiedene Methoden erfolgen, wie zum Beispiel Beobachtungen, Messungen oder Befragungen. Dabei sollte auch geprüft werden, ob durch die Umsetzung der Maßnahmen möglicherweise neue Gefährdungen entstanden sind.
Die Wirksamkeitsprüfung sollte zeitnah nach der Umsetzung der Maßnahmen erfolgen. Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, kann es sinnvoll sein, die Überprüfung durch eine zweite geeignete Person durchführen zu lassen.
Falls die Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen, müssen alternative oder zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Ein Beispiel hierfür wäre die Kontrolle, ob ein Arbeitsplatzgrenzwert durch eine neue Absaugung eingehalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, sind weitere Maßnahmen erforderlich, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten.
Schritt 7: Schreiben Sie die Gefährdungsbeurteilung fort und dokumentieren Sie diese
Ein systematischer Arbeitsschutz erfordert, dass Sie die Gefährdungsbeurteilung kontinuierlich fortschreiben und aktuell halten. So tragen Sie zur Weiterentwicklung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses bei.
Sie sollten die Gefährdungsbeurteilung regelmäßig überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Anlassbezogene Überprüfungen sind notwendig, wenn beispielsweise neue Gefährdungen erkannt werden, Unfälle oder Beinaheunfälle auftreten, Änderungen in der Arbeitsorganisation oder den Prozessabläufen erfolgen oder neue Vorschriften und technische Entwicklungen eingeführt werden.
Dokumentieren Sie die Gefährdungsbeurteilung gemäß § 6 ArbSchG („Dokumentation“) entweder in Papierform oder elektronisch. Wichtig ist, dass alle Schritte der Gefährdungsbeurteilung nachvollziehbar festgehalten werden. Dazu gehört die Beurteilung der Gefährdungen, die Festlegung und Durchführung von Maßnahmen, die Überprüfung der Wirksamkeit sowie das Datum der Erstellung oder Aktualisierung.
Fügen Sie relevante Unterlagen wie Messprotokolle, Betriebsanweisungen oder Prüfprotokolle in die Dokumentation ein. Diese Nachweise belegen die Wirksamkeit der Maßnahmen und den arbeitssicheren Zustand von Arbeitsmitteln und Anlagen.
Wer darf eine Gefährdungsbeurteilung erstellen?
Grundsätzlich dürfen Sie als Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung selbst erstellen, da Sie laut Gesetz die Verantwortung für den Arbeitsschutz in Ihrem Betrieb tragen. Sie können jedoch fachkundige Personen hinzuziehen, wie beispielsweise eine Sicherheitsfachkraft oder einen Betriebsarzt.
Die gesetzliche Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung finden Sie im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), genauer in § 5 ArbSchG. Dort ist festgelegt, dass Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zum Schutz Ihrer Beschäftigten zu ergreifen.
Gibt es bei der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung Formvorschriften ?
Wenn Sie eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, gibt es keine einheitlich gesetzlich vorgeschriebene Form. Dennoch sind bestimmte Vorgaben für die schriftliche Dokumentation einzuhalten. Sie können die Gefährdungsbeurteilung entweder in Papierform oder elektronisch festhalten, je nachdem, was für Ihren Betrieb am besten geeignet ist. Dabei ist es entscheidend, dass die Gefährdungsbeurteilung nachvollziehbar und vollständig ist, damit sie im Bedarfsfall als Nachweis dient.
Vorlagen können Ihnen dabei als Orientierungshilfe dienen, sollten jedoch immer an die spezifischen Bedingungen und Tätigkeiten in Ihrem Unternehmen angepasst werden. Eine Unterschrift ist nicht zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um die fachkundige Beratung durch eine Sicherheitsfachkraft oder einen Betriebsarzt zu belegen.
Was kostet eine Gefährdungsbeurteilung?
Die Kosten für eine Gefährdungsbeurteilung beginnen bei der Arbeitssicherheit.GmbH ab 480 Euro pro Stück. Diese Beurteilung wird rechtssicher und nach aktuellen Standards durchgeführt und von einer erfahrenen Fachkraft für Arbeitssicherheit erstellt. Nach Erhalt ist Ihre Gefährdungsbeurteilung für Sie unbegrenzt nutzbar.
Was tun bei fehlender Fachkunde?
Wenn Ihnen die erforderlichen Fachkenntnisse zur Bewertung der Gefährdungen fehlen, können Sie Unterstützung von Experten wie den Fachkräften für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzten der Arbeitssicherheit.GmbH einholen. Wir stehen Ihnen deutschlandweit zur Verfügung, wenn Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung von Profis erstellen lassen möchten.